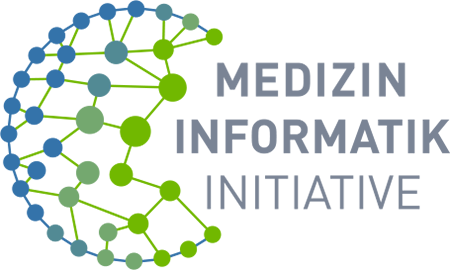Leipzig, 26.01.2023. Vor allem ältere Menschen nehmen häufig mehrere Medikamente gleichzeitig ein. Dabei besteht jedoch die Gefahr von unerwünschten Arzneimittelwechsel- und -nebenwirkungen. Zusätzliche Krankheitsbilder und Therapiebedarf können die Folge sein. Um dieses Problem anzugehen, hat sich in der vergangenen Förderphase der Medizininformatik-Initiative (MII) der konsortienübergreifende Use Case POLAR mit der Ermittlung von potentiell inadäquaten Medikationen befasst. Das interdisziplinäre Projektteam arbeitete daran, über die Erfassung von Medikationsdaten mögliche Risiken vorherzusagen. Im Januar 2023 hat nun das POLAR-Folgeprojekt INTERPOLAR begonnen. Über die bestehende IT-Infrastruktur der MII soll die Medikationssicherheit verbessert werden.
Zu diesem Anlass hat das SMITH-Konsortium der MII mit Prof. Dr. Petra Thürmann und Dr. Beate Mussawy gesprochen. Sie sind Expertinnen auf dem Gebiet der Pharmakologie und Pharmazie und haben POLAR seit Projektbeginn pharmakologisch betreut. Im Interview geben sie einen Einblick in den Use Case INTERPOLAR und erklären, wie im Projekt mittels Datenanalysen die Arzneimittelsicherheit verbessert werden kann.
Sie beschäftigen sich beide bereits seit vielen Jahren mit potenziell inadäquater Medikation (PIM) von älteren Menschen. Wie sind Ärztinnen und Ärzte bislang mit der Verschreibung unterschiedlichster Arzneimittel (Polypharmazie) umgegangen?
Dr. Beate Mussawy: Im Alltagsgeschehen ist es manchmal nicht einfach, alles im Blick zu behalten. Für die korrekte Einschätzung wäre eigentlich eine komplette Re-Evaluation der Erkrankung der Patientin bzw. des Patienten und der dafür benötigten Medikation nötig. Mir ist aufgefallen, dass insbesondere das Absetzen von Arzneimitteln vielen Ärztinnen und Ärzten schwerer fällt als das Ansetzen von neuen Medikamenten. Häufig sind mehrere Fachrichtungen an der Therapie von Patientinnen und Patienten beteiligt. Deshalb kennen die Behandelnden gerade im ambulanten Sektor und zum Teil auch im stationären Bereich manchmal die vollständige Medikation der Patientinnen und Patienten gar nicht. Es ist sicherlich wichtig, hier eine Hilfestellung zu haben, um möglichst schnell Arzneimittel zu identifizieren, die Probleme bereiten können.
Prof. Dr. Petra Thürmann: Ich würde die Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Einmal aus dem ambulanten Bereich für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und einmal für Krankenhausärztinnen und -ärzte. Wenn wir mit ersterem anfangen: Hausärztinnen und -ärzte kennen ihre Patientinnen und Patienten meist schon sehr lange und haben deshalb mit der bisherigen Medikation häufig keine Probleme. Sie müssen eher einen Weg finden damit umzugehen, wenn sich zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt oder durch fachärztliche Verordnungen etwas ändert. Dabei tritt häufig das Problem auf, dass die Hausärztinnen und -ärzte bisher oftmals keine vollständigen Informationen hatten. Die Patientin oder der Patient sagt dann so etwas wie: „Ich habe vom Orthopäden ein neues Schmerzmittel bekommen, aber wie es genau heißt kann ich Ihnen gerade auch nicht sagen.“ Häufig sind die Patientinnen und Patienten die einzige Informationsquelle und die Hausärztin oder der Hausarzt müssen sich irgendwie damit arrangieren.
Im Krankenhaus sehe ich das noch einmal etwas anders. Da ist die Patientin oder der Patient häufig sehr "neu". Gerade für ein Fach wie die Unfallchirurgie, wo die Patientin oder der Patient mit Polypharmazie noch nie gesehen wurde und nun mit einem Knochenbruch ankommt. Der Unfallchirurg bzw. die Unfallchirurgin sind natürlich zutiefst dankbar, wenn sie einen geschriebenen Medikationsplan vorfinden. Der Krankenhausarzt hat weder die Intention, noch die Zeit und den Überblick, die ganze Polypharmazie neu zu sortieren. Das ist auch gar nicht der Behandlungsauftrag.
Deswegen denke ich, dass für beide Settings, sowohl ambulant als auch im Krankenhaus, ganz dringend viel Unterstützung nötig ist.
Wie ist das POLAR-Projekt das Problem der Polypharmazie genau angegangen und was sind die Erkenntnisse daraus?
Dr. Beate Mussawy: Im POLAR-Projekt war der erste Schritt die Datenanalyse. Das Ziel war es, herauszufinden, inwiefern Probleme der Polymedikation im Klinikalltag relevant sind und in klinischen Routinedaten überhaupt erkannt werden können. Die zusammengefasste Datenmenge aus 13 Unikliniken kann dabei helfen, einen breiten Querschnitt abzubilden und somit die Identifikationskriterien für medikationsbezogene Probleme abzuleiten. Im POLAR-Projekt gab es eine Reihe unterschiedlicher Teilprojekte. In unserem Teilprojekt wurde die potentiell inadäquate Medikation (PIM) genauer untersucht. So konnte nach Operationalisierung der unterschiedlichen PIM-Listen beispielsweise an alle Unikliniken die Frage gestellt werden, wie viele Patientinnen und Patienten das potentiell inadäquate Medikament Amitriptylin einnehmen und gestürzt sind. Das heißt man konnte erste Assoziationsstudien machen, obwohl zunächst die Machbarkeit beim POLAR-Projekt im Vordergrund stand.
Prof. Dr. Petra Thürmann: POLAR war die erste Möglichkeit, in der deutschen Universitätsmedizin einmal zu überprüfen: Wie häufig sind bestimmte Medikamente, die man besser nicht so oft verordnen sollte? Wie häufig kommen gewisse Wechselwirkungen auch in Deutschland vor? Dieselben Fragen stellen wir uns auch mit ungünstigen Medikamenten, Krankheitskombinationen etc. Wir hatten bisher sehr viele Daten dazu aus dem Ausland. Das Besondere an der MII und POLAR ist, dass wir erstmals solche Daten aus dem Krankenhausbereich in Deutschland zur Verfügung haben und international vergleichen können.
Wir müssen erst einmal sehen, ob wir mit deutschen Routinedaten aus deutschen Krankenhäusern die Zusammenhänge zwischen ungünstigen Medikamenten und unerwünschten Ereignissen wie Stürzen, die Frau Mussawy eben erwähnte, auch finden können. Bevor wir die Welt mit ein paar neuen Befunden begeistern können, müssen wir erst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, und das haben wir in POLAR gemacht.
Am 01.01.2023 ist INTERPOLAR, das Folgeprojekt von POLAR, gestartet. Was ist bei INTERPOLAR neu?
Dr. Beate Mussawy: POLAR war ein Anwendungsfall, der sich primär mit der Datenanalyse beschäftigt hat und mit der Frage, wie häufig medikationsbezogene Probleme bei Polypharmazie auftreten. INTERPOLAR ist eine Interventionsstudie. Hier wird untersucht, ob eine auf den elektronischen Patientendaten basierende Risikoanalyse Medikationsprobleme sicher identifizieren und im Klinikalltag verringern kann. Ziel ist dabei, die knappe Arbeitszeit der Ärztinnen und Ärzte sowie klinischen Pharmazeutinnen und Pharmazeuten effizienter einsetzen zu können. Zusammenfassend kann man sagen, POLAR war Datenanalyse, bei INTERPOLAR geht es bereits um die Unterstützung der Ärzteschaft und damit auch konkret schon um den Nutzen für die Patientinnen und Patienten.
Prof. Dr. Petra Thürmann: In Ergänzung zu dem, was Frau Mussawy gesagt hat: Man muss das Ganze auch im internationalen Kontext sehen. Es gibt bisher nur sehr wenige große multizentrische Studien, die sich damit beschäftigen, die Zahl der ungünstigen Medikamente mit Wechselwirkungen bei stationär behandelten Patientinnen und Patienten zu verringern. Alle bisherigen Ansätze in der Literatur haben sich entweder nur mit potentiell inadäquater Medikation oder nur mit Wechselwirkungen, aber dann mit allen Krankenhauspatientinnen und -patienten ab einem bestimmten Alter beschäftigt. Wir versuchen, mit einem Algorithmus bereits vorher genau die Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die besonders gefährdet sind und damit von der Studie am meisten profitieren könnten. Wenn sich das als wirksam herausstellt, dann haben wir eine echte Lösung für die Praxis und nicht nur einen weiteren theoretischen Ansatz.
Was hat Sie dazu bewegt, sich als Pharmakologin bzw. Pharmazeutin für die Digitalisierung in der Medizin einzusetzen?
Dr. Beate Mussawy: Seit meinem ersten Arbeitstag am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) habe ich mit der elektronischen Patientenakte sowie der elektronischen Verschreibung gearbeitet. So habe ich die vielen Vorzüge eines hohen Digitalisierungsgrades einer Klinik miterlebt und durfte auch den stetigen Ausbau und die Weiterentwicklung der Systeme aktiv unterstützen. Ich habe unheimlich viele Vorteile festgestellt: Man muss nicht mehr die Akten suchen, es sind alle notwendigen Daten an einem Arbeitsplatz abrufbar, die Prozesse können strukturierter und gleichförmiger ablaufen. Wenn eine Patientin oder ein Patient beispielsweise von einer Station auf eine andere verlegt wird, können durch die digitale Dokumentation Informationsabbrüche vermieden werden. Die elektronische Patientenakte ist bei uns immer von überall abrufbar. Das erleichtert die Arbeit im Klinikalltag sehr. Ich bin der Meinung, dass die Digitalisierung im Krankenhaus immer weiter ausgebaut werden und auf dem aktuellen Stand bleiben sollte. So kann die Patientensicherheit effektiv erhöht werden.
Prof. Dr. Petra Thürmann: Ich komme nicht aus einem langjährig digitalisierten Krankenhaus. Das UKE war bundesweit ein echter Vorreiter, was die Digitalisierung anbetrifft. Für mich ist es gerade reizvoll, dass die Mehrzahl der Krankenhäuser auch heute noch nicht besonders digitalisiert ist. Bei all dem Fortschritt in der Medizin: Etwa fünf Prozent der Krankenhausaufnahmen beruhen noch immer auf Nebenwirkungen. Circa zehn Prozent der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, wenn sie älter sind sogar noch mehr, erleiden eine relevante Nebenwirkung. Dieses Problem wird wegen der steigenden Komplexität der medikamentösen Therapie immer größer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dem nur beikommen, wenn wir sämtliche Chancen der Digitalisierung wirklich gnadenlos ausnutzen. Ich finde es fast unethisch, die Möglichkeiten der Digitalisierung sowohl zum Erkenntnisgewinn als auch zum Umsetzen der Erkenntnisse für einzelne Patientinnen und Patienten nicht zu verwenden.
Bitte beenden Sie folgenden Satz: Die Arbeiten in der Medizininformatik-Initiative können bei konkreten klinischen Fragestellungen wie Polymedikation unterstützen, weil…
Dr. Beate Mussawy: Datenanalyse hilft, medikationsbezogene Probleme in den Kliniken zu erkennen. Durch die Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus Klinik, Medizin, Pharmazie, Biometrie und IT wird mit der MII die dafür notwendige einheitliche Dateninfrastruktur zur Verfügung gestellt.
Prof. Dr. Petra Thürmann: sie neue Erkenntnisse bringen, die sofort in die Praxis gespiegelt werden können. Das betrifft nicht nur Erkenntnisse zur Polymedikation, sondern auch zu anderen häufigen medikationsbezogenen Problemen. So kann den Patientinnen und Patienten direkt geholfen werden.
Über die Interviewpartnerinnen:
Prof. Dr. Petra Thürmann ist stellvertretende Ärztliche Direktorin des Helios Universitätsklinikums in Wuppertal. An der Universität Witten/Herdecke hat sie neben ihrer Position als Vizepräsidentin für Forschung den Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie inne. Einer ihrer bedeutendsten wissenschaftlichen Beiträge ist die Priscus-Liste, mit der Ärztinnen und Ärzte sich bei der Verschreibung von Medikamenten darüber informieren können, ob diese mit Risiken für ältere Patientinnen und Patienten verbunden sind. Prof. Dr. Thürmann ist in mehreren Gremien vertreten, darunter in der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Zudem leitet sie die Koordinierungsgruppe des Aktionsplans Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und war bis Januar 2023 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
Dr. Beate Mussawy ist Fachapothekerin für Klinische Pharmazie, Geriatrische Pharmazie und Medikationsmanagement im Krankenhaus. Sie hat zum Thema „Potentiell inadäquate Medikation für Ältere“ an der Universität Hamburg promoviert. Seit 2011 engagiert Dr. Mussawy sich als Apothekerin in der Klinikapotheke des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf für die Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit. Darüber hinaus gibt sie Weiterbildungsseminare in Klinischer Pharmazie für die Apothekerkammer Hamburg.