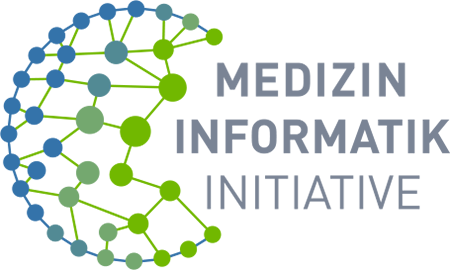24.10.2024. Im INTERPOLAR-Projekt der Medizininformatik-Initiative (MII) wird untersucht, wie IT-Lösungen die Arbeit von Stationsapothekerinnen und -apothekern unterstützen können. Nach fast zwei Jahren Vorbereitung startet das INTERPOLAR-Projekt nun in die praktische Phase: In einer mehrstufigen Studie wird das Arzneimitteltherapiesicherheits (AMTS)-Cockpit auf 48 Stationen über acht Universitätskliniken hinweg implementiert und an zufällig ausgewählten Stationen als Tool für die Medikationsanalyse eingesetzt. Das Ziel ist es, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu steigern und die knappen Ressourcen in Kliniken optimal zu nutzen. Im Interview geben Prof. Dr. André Scherag, stellvertretender Verbundkoordinator, Universitätsklinikum Jena, und Dr. Daniel Neumann, wissenschaftlicher Projektmanager in INTERPOLAR, Universität Leipzig, einen Einblick in die Hintergründe der INTERPOLAR-Studien und den Einsatz des AMTS-Cockpits.
Im INTERPOLAR-Projekt soll untersucht werden, ob Stationsapothekerinnen und -apotheker bei ihrer Medikationsanalyse von IT-Unterstützung profitieren. Welche Schritte sind hierfür im Projekt geplant?
Prof. Dr. André Scherag: Das Projekt lässt sich in drei Phasen unterteilen: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. In der Vorbereitungsphase müssen wir regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen abklären. Für die Studien und die hierfür vorgesehenen Arbeiten benötigen wir zum Beispiel ein Ethik- sowie Studienprotokoll. Eine weitere Aufgabe erwartet uns im Bereich der Dokumentation, die über die Stationen hinweg harmonisiert werden muss. Hierbei müssen die „Triggerlisten“ aktualisiert und vereinheitlicht werden. Diese Listen geben beispielsweise an, welche Medikamente nicht kombiniert werden sollten. Die eigentliche Studie läuft in zwei Phasen ab. Zuerst wird eine einheitliche Dokumentation eingeführt, dann erhalten die Stationsapothekerinnen und -apotheker nach und nach digitale Unterstützung. Aktuell haben einige Standorte bereits die technischen Voraussetzungen, um mit der Dokumentation zu beginnen.
Dr. Daniel Neumann: Wir haben viel Zeit darauf verwendet, die Arbeitsabläufe sowie die Medikationsanalyse durch Stationsapothekerinnen und -apotheker zu verstehen. Dabei haben wir umfangreiche Prozessmodelle erarbeitet und abgestimmt. Hierauf haben wir die Entscheidungen über die Medikation und die hierfür notwendigen Informationen gelegt. So konnten wir die Informationen für IT-Lösungen in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) und der Medizininformatik-Initiative entwickeln. Jeder Standort arbeitet nunmehr an der Implementierung der IT-Unterstützung und der Anbindung an die Datenintegrationszentren, bevor die Dokumentation der Patientinnen und Patienten beginnen kann.
In INTERPOLAR soll eine sogenannte „cluster-randomisierte Studie“ durchgeführt werden; dabei werden Ergebnisse nicht zwischen einzelnen Patientinnen und Patienten, sondern zwischen Stationen verglichen. Weshalb haben Sie diese Vorgehensweise gewählt?
Prof. Dr. André Scherag: Eine patientenbezogene Randomisierung wäre schwierig, da Stationsapothekerinnen und -apotheker fest bestimmten Stationen zugeteilt sind. In einer Station können nicht einige Patientinnen und Patienten mit IT-Unterstützung behandelt werden, während andere ohne bleiben. Die Randomisierung auf Stationsebene trägt dazu bei, dass stationsspezifische Faktoren keinen zu starken Einfluss auf die Ergebnisse haben. Das stufenweise Einführen der IT-Unterstützung, das sogenannte „Stepped-Wedge-Design“, erlaubt es uns außerdem, logistische Herausforderungen besser zu bewältigen. Wir können damit besser abschätzen, wie viel Mehrarbeit bei den Stationsapothekerinnen und -apothekern entsteht. Zudem können wir beobachten, wie sich die Ergebnisse im Zeitverlauf verhalten.
Dr. Daniel Neumann: Unsere Studie fokussiert sich auf die Versorgung und den bestmöglichen Einsatz der Stationsapothekerinnen und -apotheker zur Verbesserung der Patientensicherheit. Das alles spielt sich auf Stationen ab. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass Stationsapothekerinnen und -apotheker auf den jeweiligen Stationen berücksichtigt und randomisiert werden.
Auf den teilnehmenden Stationen wird das Arzneimitteltherapiesicherheits (AMTS)-Cockpit eingeführt. Wie genau läuft die Nutzung ab?
Prof. Dr. André Scherag: Das AMTS-Cockpit wird in zwei Stufen eingeführt. Zunächst dokumentieren die Stationsapothekerinnen und -apotheker potenzielle Medikationsprobleme und geben Empfehlungen an das behandelnde Ärzteteam. Bei der Dokumentation geben die Stationsapothekerinnen und -apotheker an, wo das Problem auftritt, welche Empfehlungen gegeben wurden und was zu ändern ist. Dann muss die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt entscheiden, ob die Änderung durchgeführt wird. Manchmal gibt es einen für die Stationsapothekerinnen und -apotheker nicht offensichtlichen Grund, weshalb das Medikament bewusst gegeben wurde. Beispielsweise könnte ein noch schlimmeres Risiko vorliegen, das verhindert werden muss. Im zweiten Schritt soll das AMTS-Cockpit den Stationsapothekerinnen und -apothekern digitale Informationen bereitstellen, die ihnen helfen sollen, Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die sie bei der Medikationsanalyse selbst noch nicht im Fokus hatten.
Dr. Daniel Neumann: Durch das AMTS-Cockpit bekommen die Stationsapothekerinnen und -apotheker eine Struktur und einen Überblick über ihre täglichen Tätigkeiten. Bisher wurde zwar dokumentiert, aber nicht systematisch nachverfolgt, was mit den Medikationsproblemen passiert. Das Cockpit soll hier mehr Transparenz schaffen und eine gezieltere Nachverfolgung ermöglichen. Darüber hinaus können wir in Deutschland erstmalig eine Dokumentation aufgetretener und gelöster arzneimittelbezogener Probleme schaffen. Dies ist für die weitere Forschung im Bereich von AMTS, Pharmakovigilanz und IT-Unterstützung klinischer Prozesse sehr wichtig.
Mit welchen Herausforderungen rechnen Sie bei der Implementierung einer solchen IT-Lösung?
Prof. Dr. André Scherag: Die Personen, die unsere IT-Lösung später nutzen sollen, müssen diese erst einmal akzeptieren. Deshalb haben wir die Stationsapothekerinnen und -apotheker von Anfang an in den Entwicklungsprozess einbezogen. Ob es dann noch weitere Hürden gibt, können wir erst sehen, wenn die Anwendung in die klinische Praxis eingeführt wurde. Auch bei der lokalen Implementierung der Softwarekomponenten, die vor allem in Leipzig entwickelt worden ist, könnte es zu Schwierigkeiten kommen. Das alles werden wir aber erst bei der Durchführung der Studie merken.
Dr. Daniel Neumann: Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, dass das AMTS-Cockpit unabhängig von den Krankenhausinformationssystemen läuft. Das kann zu einer Herausforderung werden, wenn Stationsapothekerinnen und -apotheker mit zwei parallelen Systemen arbeiten müssen. Deshalb müssen wir vorab gut mit den Stationsapothekerinnen und -apothekern kommunizieren. Dies setzt wiederum natürlich voraus, dass sie eine hohe Motivation haben, mitzuwirken. Nur dann kann die IT-Unterstützung auch funktionieren, wenn sie implementiert ist.
Bitte beenden Sie folgenden Satz: Ich finde, dass das INTERPOLAR-Projekt für eine verbesserte medizinische Versorgung wichtig ist, weil…
Dr. Daniel Neumann: …es erstmalig ermöglichen wird, eine systemische Forschung zwischen Versorgungssystem und IT-Unterstützung zu betrachten. Dabei kann die nachweislich wichtige Unterstützung durch Stationsapothekerinnen und -apotheker stärker in den Alltag der klinischen Routine rücken.
Prof. Dr. André Scherag: …es hoffentlich zeigt, dass digitale Tools allen Beteiligten helfen können. Es gibt immer weniger Expertinnen und Experten, aber immer mehr und ältere, multimorbide Patientinnen und Patienten. Das INTERPOLAR-Projekt bietet hier eine Lösung.
Quelle: SMITH-Konsortium